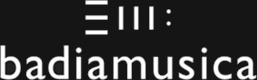Archivio (150)
Donnerstag, 17 August geschrieben von Badia Musica

3. Orgelkonzert
Kim Yeonju
Yeonju Sarah KIM wurde in Busan, Südkorea, geboren. Sie studierte Orgel und Kirchenmusik an der Kyungsung Universität in Busan bei Prof. Kyungnim Chung und an der Yonsei Universität in Seoul bei Prof. Myungja Cho und erwarb den Bachelor- und den Mastergrad mit Auszeichnung. Sie wirkte als Organistin an der Katholi¬schen Kathedrale in Seoul. 2013 absolvierte sie mit Auszeichnung das Masterstudium Konzertfach Orgel an der Universi¬tät Mozarteum bei Prof. Heribert Metzger. 2014 nahm sie am weiterbildenden Zertifikats¬studium Meisterklassen an der Hochschule für Musik und Theater München bei Prof. Bernhard Haas teil. Sie bildete sich in Meisterkursen bei André Isoir, Piet Kee, Bernhard Leonardy, Martin Sander, Luigi Ferdinando Tagliavini und Harald Vogel weiter.Yeonju Kim ist Gewinnerin mehrerer Orgelwettbewerbe (u.a. des Youngsan Orgelwett¬bewerbs und des Orgelwettbewerbs der Music Association of Daegu in Korea); sie wurde vom Bürgermeister der südkoreanischen Stadt Daegu für besondere künstlerische Leistun¬gen ausgezeichnet, darüber hinaus wurde ihr der Korean Art and Culture Association Award zuerkannt. Beim Internationalen Orgelwettbewerb Wuppertal 2013 gewann sie den 2. Preis. 2014 erhielt sie den 2. Preis (bei Nichtvergabe des 1. Preises) beim Internationa¬len Franz-Schmidt-Orgelwettbewerb Kitzbühel. Sie erspielte sich den geteilen 1. Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb Daniel Herz in Brixen 2016.
Der Titel des Programms „Meine Seele erhebt den Herren“ verweist, als Übersetzung ins Deutsche, auf das „Magnificat“, den Lobgesang der schwangeren Maria auf ihren Gott und Herrn. Dieses Gebet hat seinen festen Platz im Abendgebet der Kirche, in der Vesper. Wird es gesungen, so geschieht das auf verschiedene Psalmtöne, d.h. Melodietypen, die durch Jahrhunderte auch den Kompositionen bedeutender Meister zugrunde lagen; dabei konnte es sich um Orgelsätze handeln, die alternierend zum Gesang gespielt wurden, oder um Einzelsätze (Pachelbel, Bach) oder auch um Choralfantasien (Buxtehude).
Die Tatsache, dass alle Magnificat-Vertonungen dieses Programms von protestantischen Komponisten geschaffen wurden, zeigt, welch hohen Stellenwert dieser Lobgesang von jeher auch bei den evangelischen Christen hatte. Von Martin Luther ist uns eine ebenso umfangreiche wie tiefsinnige Betrachtung zum Lobgesang Mariens überliefert.
„Meine Seele erhebt den Herren“
„Magnificat“
Dieterich Buxtehude
(1637-1707)
Toccata in d, BuxWV 155
Canzona in G, BuxWV 170
Magnificat primi toni, BuxWV 203
Johann Pachelbel
(1653-1706)
Fantasia in g
Meine Seele erhebt den Herren
(Magnificat peregrini toni – Alio modo)
Ciacona in f
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
„Meine Seele erhebt den Herren“, BWV 648
Fuge in G, BWV 577
Toccata und Fuge in d, BWV 538
Publiziert in Archivio
Mittwoch, 16 August geschrieben von Badia Musica

Ensemble Windkraft - Kapelle für Neue Musik & I Virtuosi Italiani
Ensemble Windkraft
Windkraft – Kapelle für Neue Musik & I Virtuosi Italiani
Kasper de Roo, Dirigent
Das Anhören des Stückes Stardust von Konrad Tavella ist wie das Lesen eines Buches. Wir begegnen darin Hauptfiguren und Nebenfiguren. Je mehr wir beim Lesen das Geschehen erfahren, umso mehr werden uns diese Figuren mit ihren Charakteren verwandt. Charakteren der einzelnen Figuren, die heranwachsen und wandeln und in neuen Kontexten ihre eigentliche Natur entfalten. Die Struktur der Komposition ist in 3 Kapitel gegliedert. Der erste Teil vermittelt schwermütige Unruhe, der zweite ist sehr energisch und resolut aber doch mit einem Hauch von Zärtlichkeit. Der letzte Teil ist ein Gegenstück zum ersten Teil, aber doch nicht ganz und stellt eine hell leuchtende Idee vor.Windkraft – Kapelle für Neue Musik & I Virtuosi Italiani
Kasper de Roo, Dirigent
Die 9. Sinfonie von Gustav Mahler stellt nicht nur das letzte Werk des Komponisten dar, sondern ist zugleich der Höhepunkt dieser Kompositionsform.
Mahler komponiert dieses Werk im Sommer des Jahres 1909 in Toblach, wo er sich nach dem Tode der Tochter Marie zurückgezogen hatte. Außerdem plagten ihn selbst gesundheitliche Probleme verbunden mit Herz und Kreislaufsystem. In Toblach beendete er auch "das Lied der Erde" und begann mit den Skizzen der 10. Sinfonie, welche er dann nie vollendete.
Diese 9. Sinfonie wurde am 26. Juni 1912 in Wien von den Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Bruno Walter uraufgeführt.
Die Form dieser Komposition beruht auf das Gleichgewicht der dreier Partie und der zweier Partie. 3 gegen 2 bildet eine unstabile Proportion, welche wir auch in den kleinen Modulen finden. Diese Beziehung ist nicht nur ein formales Prinzip, sondern zugleich eine poetische Funktion.
Die 2 mittleren Hauptsätze sind eigentlich eine einzige Konstruktion. Beide zusammen haben die gleiche Dauer wie der Anfang-und Schlusssatz.
Obwohl Mahler seine Themen vertiefte, wird hier die Kompositionstechnik erweitert auf der Suche nach einer sinfonischen Expressivität.
Diese Version der Sinfonie wurde 2011 in der Kammermusikfassung von Klaus Simon in Berlin vorgestellt.
Windkraft – Kapelle für Neue Musik, ein Orchester bestehend aus Holz- und Blechbläsern, als Verein grenzüberschreitend in Nord- und Südtirol tätig, reiht sich seit seiner Gründung 1999 auf besondere Weise in die Reihe der Spezialensem¬bles im Bereich der Neuen Musik ein.
Neben zahlreichen Auftritten bei verschiedenen Festivals im In- und Ausland war Windkraft im Juli 2014 als Ensemble in Residence beim Bejing International Composition Workshop eingeladen und trat im Mai 2015 in der Abo-Reihe „Nouvelles Aventures“ im Wiener Konzerthaus auf.
Windkraft wird von den Kulturabteilungen der Südtiroler und Tiroler Landesregierungen unterstützt.
Das Kammerorchester I Virtuosi Italiani wurde 1989 gegründet und stellt heute eine hoch quali¬fizierte und aktive Kammermusikformation auf internationalem Niveau dar. Zahlreiche Tourneen führen das Kammerorchester zu namhaften Festivals auf der ganzen Welt. Auch auf diskografischem Sektor sind die Virtuosi Italiani höchst produktiv, mehr als 100 CD-Einspielungen und an die 450.000 weltweit verkaufte CDs zeugen von ihrer beachtlichen Aktivität.
Kasper de Roo ist ein international renommierter Interpret der Musik des 20. und 21. Jhs. Seine schnelle Karriere brachte ihn zunächst 1984 als Kapellmeister an die Staatsoper Stuttgart, ab 1992 als Musikdirektor nach Innsbruck und 1994 gleichzeitig als Chefdirigent zum National Symphony Orchestra of Ireland nach Dublin. Seit 1999 ist er künstlerischer Leiter von Windkraft - Kapelle für neue Musik. Als Gastdirigent gegenwärtig Auftritte in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Peking, Hongkong, Hamburg, Frankfurt, Köln, Dresden, Wien und Salzburg.
Konrad Tavella 1981 in Bruneck geboren, beginnt sein Kompositionsstudium am Bozner Konservatorium „C. Monteverdi“ und schließt es 2009 bei Paolo Rimoldi am Mailänder Konservatorium „G. Verdi“ ab. Gleichzeitig diplomiert er mit Höchstpunktezahl in Musikwissenschaften mit einer Abschlussarbeit über den berühmten Violinisten Giuseppe Tartini. Sein Repertoire umfasst Kompositionen zeitgenössischer Musik wie Stücke für Hornquartette (Hornquartet, 2005), für Harfe, Flöte und Paetzold (Air, 2012) und für Ensemble (Hommage a Stravinsky, 2015). Er bearbeitete traditionelle ladinische Musik für Bläserquintett (Potpurri, 2011) und für Musikkapelle (Le ciastel dles stries, 2012). Kürzlich hat Tavella Musik für Theaterstücke komponiert und bearbeitet, u.a. die Szenenmusik für das Theaterstück „Quella musica ricordo“ (2014) und die Musik für die erste ladinische Operette „Le ciastel dles stries“ aus dem Jahre 1884, welche 2014 in einer überarbeiteten Version für Jugendliche aufgeführt wurde. Er unterrichtet Musikerziehung an der Mittelschule „Tita Alton“ in Stern und leitet den Kirchenchor Stern im Gadertal und den Chor Raiëta in Wengen.
“Die Musik, die die Zukunft mit den Mitteln der Vergangenheit voraussagt”
Programm
Konrad Tavella
(*1981)
Stardust (2016)
Gustav Mahler
(1860-1911)
9. Symphonie in D-Dur in Kammermusikbesetzung
1. Andante comodo, Mit Wut, Allegro risoluto, Leidenschaftlich, Tempo I Andante
2. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb
3. Rondò Burleske: Allegro assai. Sehr trotzig
4. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend
Publiziert in Archivio
Montag, 14 August geschrieben von Badia Musica

Zeisprung Consort
Johannes Vogt, Laute, Theorbe
Daniel Kartmann, Schlagzeug, Percussion und Stimme
Rüdiger Kurz, Violone
Zeitsprung Consort: Drei Gefährten auf der Suche nach dem Strandgut vergangener JahrhunderteDaniel Kartmann, Schlagzeug, Percussion und Stimme
Rüdiger Kurz, Violone
„Wo soll ich mich hinkeren ...?“ war ein bekannter Gassenhauer in der Renaissance und ist das Motto der drei Künstler Johannes Vogt (Laute), Rüdiger Kurz (Violone) und Daniel Kartmann (Schlagzeug & Stimme). Sie kommen aus unterschiedlichen Richtungen, sie sind neugierig und stets auf der Suche nach neuen Klangräumen. Das Interesse für Lyrik, für Geschichten und für sozial-politische Umstände inspiriert die Band immer wieder zu eigenen Songs und Arrangements. Sie lassen sich gerne treiben: von Ideen, Klängen und Rhythmen. Sie nähren sich vom Strandgut vergangener Jahrhunderte für ihren individuellen, modernen Bandsound. Das Motto „Wo soll ich mich hinkeren...?“ ist mehr als nur ein traditionell–festgelegtes Konzertprogramm. Es umfasst alte Tänze, Toccaten und Sonaten aus Deutschland, Österreich und Italien sowie den einen oder anderen Gassenhauer der frühen Opernliteratur. Ein Schwerpunkt ist das Werk des Lautenvirtuosen und Komponisten Hans Judenkünig (ca. 1450–1526). So werden die Musiker auch zu eigenen Songs und Improvisationen über Stücke u.a. von Monteverdi, Bassani oder Judenkünig inspiriert. In der besonderen Besetzung mit Laute, Violone, Percussion und Gesang entfalten sie ihren ganz besonderen Reiz.
Johannes Vogt (Laute, Theorbe) studierte Klassische Gitarre und Musikwissenschaften in Heidelberg sowie Laute und Klassische Gitarre bei Tadashi Sasaki in Aachen. Er spezialisierte sich auf Lauten, Theorben und historische Gitarren. Neben zahlreichen Konzerten mit Musik aus Mittelalter, Renaissance, Barock und Klassik begeistert er mit improvisierter Musik zwischen Jazz und Weltmusik in verschiedenen Ensembles. Veröffentlichungen diverser CD-Produktionen belegen sein breit gefächertes Schaffen. Bei Barockopern ist Johannes Vogt gefragter Lautenist und wirkt auch bei modernen Opern als E-Gitarrist mit. Er hatte u.a. Lehraufträge für Laute und Generalbassspiel an der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim und für Gitarre an der Fachhochschule für Musiktherapie Heidelberg.
Daniel Kartmann (Schlagzeug, Percussion und Stimme) in Rumänien geboren, studierte klassisches Schlagzeug sowie Jazz und Popularmusik an der Hochschule Stuttgart. Anschließend entfaltete er eine umfangreiche Tätigkeit als Schlagzeuger, Pauker, Percussionist, Vibraphonist, Komponist, Sänger und Schauspieler. Er arbeitet in verschiedensten Musikgenres u.a im "Ensemble Materialtheater Stuttgart", am Staatstheater Stuttgart, der Württembergischen Landesbühne Esslingen, den Formationen „Tuyala“, „Zakuska“, „Ensemble Percorda“ etc. Es folgten Einladungen u.a. zu den Salzburger Festspielen (2009), den Ludwigsburger Schlossfestspielen (2013) und zu Blickfelder Zürich (2013). Rundfunkaufnahmen und CD-Einspielungen runden sein künstlerisches Schaffen ab. Seit 2007 spielt Kartmann die Reihe „danopticum“ im Jazzclub Kiste und leitet auch das gleichnamige Festival.
Rüdiger Kurz (Violone) studierte Kontrabass an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bei Prof. Ulrich Lau und Historische Interpretationspraxis / Violone bei Dane Roberts an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Er tritt vor allem im Bereich der historischen Aufführungspraxis auf (u.a. Il Gusto Barocco, Concerto Köln, L‘arpeggiata, Holland Baroque, Ensemble der Ludwigsburger Schlossfestspiele, Hofkapelle München, la Banda, Stiftsmusik Stuttgart). Konzertreisen führen ihn durch Europa und wiederholt in die USA. Seit den 1990ern spielt er durchgängig in diversen Band-, Songwriter- und Improvisations-Kontexten v.a. mit dem Gitarrist Shawn Maguire und „Akkordsport“. Zwischenzeitlich war er künstlerischer Leiter und Initiator von „ZOO“, einer Musiktheaterinstallation für Kinder und Jugendliche, dem „Tauffest für Georg Daniel Speer“ und gestaltete eine Spielzeit über den Stuttgarter Hof für „Il Gusto Barocco“.
" Wo soll ich mich hinkeren "
„Dove mi devo volgere“
„Dove mi devo volgere“
Programm
Claudio Monteverdi
(1567-1643)
La Musica (L´Orfeo)
Giresun Karsilamasi
türkisch, traditionell
Bartolomeo de Selma y Salaverde
(1580-1640)
Fantasia Basso solo
Claudio Monteverdi
La Musica (L´Orfeo)
Johannes Vogt
(*1953)
La Follia leggera
Hans Judenkünig
(ca 1450-1526)
Das erst Priamell
Wo soll ich mich hinkeren
Anonym, 16. Jht
Der Fürstin Pauren Danntz
Der Auff und Auff
Hans Judenkünig
Das ander Priamell
Giovanni Battista Vitali
(1632-1692)
Ruggiero
Passa Galli
Andreas Gryphius/ Daniel Kartmann
(1616-1664 *1976)
Alles ist eitel
Hans Newsidler
(1508-1563)
Gassen hauer
Orazio Bassani
(1570-1615)
Tocata
Daniel Kartmann
(*1976)
Was bleibt ist Wüste
Publiziert in Archivio
Mittwoch, 09 August geschrieben von Badia Musica

Bartmes quartet & Fola Dada
Fola Dada, vocals
Frank Spaniol, bass clarinet
Jo Bartmes, hammond organ
Oli Rubow, drums, electronics
"Bartmes reißt mit seinen Mitstreitern genüsslich wie abenteuerlich die Grenzzäune zwischen freiem Ausdruck, Clubtauglichkeit und Progressivität nieder." schreibt die Frankfurter Rundschau undFrank Spaniol, bass clarinet
Jo Bartmes, hammond organ
Oli Rubow, drums, electronics
das Jazzpodium schreibt über Bartmes: "Seine schnörkellosen, vielschichtigen und eigenwilligen Ideen heben sich wohltuend vom Mainstreambrei ab."
Mal zielt der emotionsgeladene Gesang direkt in Bauch und Herz, dann transportiert ein Hammond-Solo den Geist der Doors ins 21. Jahrhundert und eine gepfiffene Melodie entführt in die italienische Filmwelt der Sechziger. Eindringlich umspielt von der Bassklarinette, die über weite Strecken mit Wah-Wah und Delay Effekten zur geblasenen Rhythmusgitarre wird und getragen von treibenden Jazz-House-Indie-TripHop-Break-Beats trifft sich alles im jetztzeitigen Club, wo sich die verschiedenen Stile und Spielarten aktueller Jazz- und Groovemusik gegenseitig zum Tanzen bringen, bis einem schwindlig wird.
"flowmotion"
Programm
Jo Bartmes
(1964)
High Taste Let It Be
Light At The End
Princess
Mood 1
Strange
The Source
_ _ _ _ _ _ _
Move
Human
The Road Ahead
Different
Maneuver
Wake Me Up
Fair Love
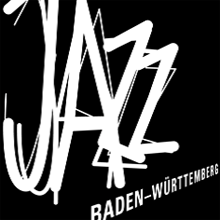
Publiziert in Archivio
Montag, 07 August geschrieben von Badia Musica

2° Orgelkonzert in Badia
Franz Comploi, Orgel
„Quartetto di Lucia“
Lucia Kastlunger, Gesang
Volker Heuken, Vibraphon , Arrangements
Alex Bayer, Bass
Jan F. Brill, Schlagzeug
"Quartetto di Lucia"„Quartetto di Lucia“
Lucia Kastlunger, Gesang
Volker Heuken, Vibraphon , Arrangements
Alex Bayer, Bass
Jan F. Brill, Schlagzeug
Der Vibraphonist Volker Heuken arrangiert für das „Quartetto di Lucia“ bekannte und weniger bekannte Stücke aus der Klassik um und präsentiert sie mit der Band in einem neuen Gewand. Es wird in der Zusammenarbeit mit dem Organist Franz Comploi zu einer Gegenüberstellung der Klassik mit der Moderne des Jazz kommen, jedoch wird der musikalische Geist der Werke derselbe bleiben.
Volker Heuken (geb 1990 in Leverkusen) studierte u.a. bei Roland Neffe, ist Mitglied des Landes- Jugend-Jazz-Orchesters Bayern und Initiator des Festivals „Vibraphonissimo“ sowie der Reihe „Brozzijazz“ in Nürnberg. Derzeit studiert er in Leipzig Master Komposition bei Prof. Michael
Wollny. Er trat mit diversen Ensembles international in vielen bekannten Jazzclubs (Porgy & Bess Wien, Jazzstudio Nürnberg, BIX Stuttgart, Unterfahrt München) sowie zahlreichen Festivals auf (Leverkusener Jazztage, Jazztage Mainz, Jazzfest Bonn, Jazzfestival Würzburg).
Alex Bayer ist einer der aktivsten Bassisten der bayerischen Jazz-Szene. Als Komponist und Improvisator liebt er Grenzüberschreitungen und die expressive Geste. So nimmt es nicht wunder, dass er regelmäßig in verschiedensten Stilistiken (Jazz, Indie, Hip Hop, Folk, Metal, Latin, World, Electronic, Funk...) anzutreffen ist und mit seinem eigenen Projekt „Pentelho“ ein eklektizistisches, wild energisches Quintett durch die Clubs jagt.
Jan Frederik Brill (geb. 1991 in Lauf a. d. Pegnitz) studierte Jazzschlagzeug in Nürnberg und Köln (u.a. bei Jonas Burgwinkel). Mit dem Kölner Klavier Trio „TURN“ gewann er bereits mehrere Preise. Als Sideman in diversen Bands konzertiert er regelmässig in Mitteleuropa und war bereits an
10 CD-Produktionen beteiligt. Als Initiator der Konzertreihen „Brozzijazz“ und „Jazz am Bahnhof“, beteiligt er sich stark am Schaffen der Jazzszene in Franken.
Lucia Kastlunger (geb 1991 in Bruneck) ist Sängerin, Pädagogin und Musikerin. Sowohl durch ihre musikalische Familie sowie regelmäßigen Unterricht in der Musikschule, entwickelte Lucia schon in der frühsten Kindheit ihre Liebe zur Musik, besonders zum Gesang.
In München studiert sie von 2010 bis 2013 „Rock-Pop-Jazz“ an der Berufsfachschule für Musik „Jazz-School“ und anschließend an der Hochschule für Musik Nürnberg bei Reinette Van Zijtveld-Lustig und Fola Dada Jazz-Gesang. Durch ihre Offenheit und das Interesse an verschiedenen Stilrichtungen gewinnt ihre Stimme zunehmend an Vielseitigkeit und Farbenreichtum. Ihr Ziel ist es durch ihre Originalität, ihre Intuition und vor allem durch ihre Individualität einen eigenen Klang zu entwickeln.
Mit dem Quartett tritt dialogisierend Franz Comploi hinzu, Domorganist von Brixen und Musikdozent.
„Begegnungen“ – „ Incontri“ – „incuntades“
Programm
J. S. Bach
(1685-1750)
Praeludium Es -Dur BWV 552/1
Volker Heuken
(*1990)
Prelude (das Bachstück)
Erik Satie
(1866-1925)
Gnossienne No. 4
Franz Comploi
(*1954)
Improvisation: Intermezzo I
Edvard Grieg
(1843-1907)
Melodie
Erik Satie
Gymnopedie No 1
Franz Comploi
Improvisation: Intermezzo II
J.S. Bach
Air
Fuge Es -Dur BWV 552/2
Publiziert in Archivio
Sonntag, 06 August geschrieben von Badia Musica

2° Orgelkonzert in Campill
Franz Comploi, Orgel
„Quartetto di Lucia“
Lucia Kastlunger, Gesang
Volker Heuken, Vibraphon, Arrangements
Alex Bayer, Bass
Jan F. Brill, Schlagzeug
"Quartetto di Lucia"„Quartetto di Lucia“
Lucia Kastlunger, Gesang
Volker Heuken, Vibraphon, Arrangements
Alex Bayer, Bass
Jan F. Brill, Schlagzeug
Der Vibraphonist Volker Heuken arrangiert für das „Quartetto di Lucia“ bekannte und weniger bekannte Stücke aus der Klassik um und präsentiert sie mit der Band in einem neuen Gewand. Es wird in der Zusammenarbeit mit dem Organist Franz Comploi zu einer Gegenüberstellung der Klassik mit der Moderne des Jazz kommen, jedoch wird der musikalische Geist der Werke derselbe bleiben.
Volker Heuken (geb 1990 in Leverkusen) studierte u.a. bei Roland Neffe, ist Mitglied des Landes- Jugend-Jazz-Orchesters Bayern und Initiator des Festivals „Vibraphonissimo“ sowie der Reihe „Brozzijazz“ in Nürnberg. Derzeit studiert er in Leipzig Master Komposition bei Prof. Michael
Wollny. Er trat mit diversen Ensembles international in vielen bekannten Jazzclubs (Porgy & Bess Wien, Jazzstudio Nürnberg, BIX Stuttgart, Unterfahrt München) sowie zahlreichen Festivals auf (Leverkusener Jazztage, Jazztage Mainz, Jazzfest Bonn, Jazzfestival Würzburg).
Alex Bayer ist einer der aktivsten Bassisten der bayerischen Jazz-Szene. Als Komponist und Improvisator liebt er Grenzüberschreitungen und die expressive Geste. So nimmt es nicht wunder, dass er regelmäßig in verschiedensten Stilistiken (Jazz, Indie, Hip Hop, Folk, Metal, Latin, World, Electronic, Funk...) anzutreffen ist und mit seinem eigenen Projekt „Pentelho“ ein eklektizistisches, wild energisches Quintett durch die Clubs jagt.
Jan Frederik Brill (geb. 1991 in Lauf a. d. Pegnitz) studierte Jazzschlagzeug in Nürnberg und Köln (u.a. bei Jonas Burgwinkel). Mit dem Kölner Klavier Trio „TURN“ gewann er bereits mehrere Preise. Als Sideman in diversen Bands konzertiert er regelmässig in Mitteleuropa und war bereits an
10 CD-Produktionen beteiligt. Als Initiator der Konzertreihen „Brozzijazz“ und „Jazz am Bahnhof“, beteiligt er sich stark am Schaffen der Jazzszene in Franken.
Lucia Kastlunger (geb 1991 in Bruneck) ist Sängerin, Pädagogin und Musikerin. Sowohl durch ihre musikalische Familie sowie regelmäßigen Unterricht in der Musikschule, entwickelte Lucia schon in der frühsten Kindheit ihre Liebe zur Musik, besonders zum Gesang.
In München studiert sie von 2010 bis 2013 „Rock-Pop-Jazz“ an der Berufsfachschule für Musik „Jazz-School“ und anschließend an der Hochschule für Musik Nürnberg bei Reinette Van Zijtveld-Lustig und Fola Dada Jazz-Gesang. Durch ihre Offenheit und das Interesse an verschiedenen Stilrichtungen gewinnt ihre Stimme zunehmend an Vielseitigkeit und Farbenreichtum. Ihr Ziel ist es durch ihre Originalität, ihre Intuition und vor allem durch ihre Individualität einen eigenen Klang zu entwickeln.
Mit dem Quartett tritt dialogisierend Franz Comploi hinzu, Domorganist von Brixen und Musikdozent.
„Begegnungen“ – „ Incontri“ – „incuntades“
Programm
J. S. Bach
(1685-1750)
Praeludium Es -Dur BWV 552/1
Volker Heuken
(*1990)
Prelude (das Bachstück)
Erik Satie
(1866-1925)
Gnossienne No. 4
Franz Comploi
(*1954)
Improvisation: Intermezzo I
Edvard Grieg
(1843-1907)
Melodie
Erik Satie
Gymnopedie No 1
Franz Comploi
Improvisation: Intermezzo II
J.S. Bach
Air
Fuge Es -Dur BWV 552/2
Publiziert in Archivio
Montag, 31 Juli geschrieben von Badia Musica

Piano Recital, Roberto Cominati
Roberto Cominati, Klavier
Roberto Cominati, am Tag nach seinem Recital bei den Salzburger Festspielen schrieb die Zeitschrift „Salzburger Nachrichten“: „...Unendlich sind seine fein nuancierten Anschläge, wenn er Debussys Pracht und dessen reizvolle Klangatmosphäre exploriert, bezaubernd ist die Mischung von Wärme und feiner Technik in Ravels Tombeau de Couperin, unvergesslich ist seine leidenschaftliche Kälte in der schwankenden und untiefen Transkription von La Valse...“Erster Preisträger 1991 des Internationalen „Alfredo Casella“-Wettbewerbs in Neapel, gewann er die Aufmerksamkeit der Kritik und der internationalen Konzertinstitutionen dank dem ersten Preis 1993 beim Internationalen „Busoni“-Wettbewerb in Bozen. Er erhielt außerdem den „Prix Jacques Stehman” des Publikums des belgischen Fernsehens und des französischen Senders TV5 beim Concours Reine Elisabeth in Brüssel.
Er hat mit berühmten Dirigenten wie Sir Rattle, Gatti, Boreyko, Fleischer, Harding, Robertson, Battistoni, Mariotti und Valchua zusammengearbeitet.
In der nächsten Saison wird er mit bedeutenden internationalen Orchestern auftreten, sich als Recital-Pianist insbesondere mit dem gesamten Solo-Klavierwerk von Ravel (2011 für Amadeus aufgenommen) auseinandersetzen und der Promotion seiner neusten CD-Aufnahme (Transkription für Klavier von Händel und Bach für Acousence) widmen.
„Es war schön sonnig: alles war klar und transparent, nur in den Herzen der Menschen war es finster."
M. Rigoni Stern
Programma
Debussy
(1862-1918)
Nocturne
Suite Bergamasque
L'Isle Joyeuse
Debussy-Borwick
(1868-1925)
Prélude à l'aprés midi d'un faune
Wagner-Moszkowski
(1813-1883/1854-1925)
Isoldens Tod
Strawinsky-Agosti
(1882-1971/1901-1989)
L'oiseau de feu
Publiziert in Archivio
Samstag, 29 Juli geschrieben von Badia Musica

Sonate
Mara Miribung, Barockcello
Daniel Rosin, Barockcello
Josep Maria Martí Duran, Theorbe
“Das Solospielen ist auf diesem Instrument eben nicht eine so gar leichte Sache, Wer sich hierinne hervorthun will, der muss von der Natur mit solchen Fingern versehen sein, die lang sind, und starke Nerven haben, um weit auseinander greifen zu können. Wenn sich aber diese nothwendigen Eigenschaften, nebst einer guten Anweisung zugleich beysammen finden; so kann, auf diesem Instrumente, sehr viel Schönes hervorgebracht werden. Ich habe selbt einige große Meister gehöret, die auf diesem Instrumente bey nahe Wunder gethan haben.” (Johann Joachim Quantz (1697-1773): Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (1752) - Kapitel “Über den Violoncellisten insbesondere”)Daniel Rosin, Barockcello
Josep Maria Martí Duran, Theorbe
Wenn der berühmte Quantz um 1750 das cellistische Solospiel noch als bemerkenswerte Besonderheit erscheinen lässt, liegt die Vermutung nahe, dass das Violoncello zu dieser Zeit von großen Teilen der breiten musikalischen Öffentlichkeit noch in erster Linie als Begleit-Instrument wahrgenommen wurde. Während diese Continuo-Funktion viel umfassender gewesen sein muss, als man lange Zeit geahnt hat (akkordisches Generalbassspiel im vollwertigen, zum Teil ausschließlichen Gegenpart einer Oberstimme), so stand das virtuose Prestige des Cellos bestimmt stark im Schatten der Geigenliteratur.
Die Violine hatte sich schon während des ganzen 17. Jahrhunderts als Soloinstrument gefestigt, und im Hochbarock hatten fast alle großen Komponisten insbesondere zur deren riesigem Sonaten-Repertoire beigetragen. In Italien hatten nun zunehmend spezialisierte “Bass-Violinen”-Spieler begonnen, auch ähnliche Werke für das Instrument zu schreiben, das wir heute Violoncello nennen.
Der Weg, den nun diese Musik und das Violoncello innerhalb des 18. Jahrhunderts gingen, demonstriert exemplarisch einige der interessantesten, musikgeschichtlichen Phänomene des barocken Europas und erzählt beredt von kultureller Assimilation und musikalischer Globalisierung.
Allgemein als explizit italienisches Instrument verstanden, ist das Violoncello und seine Musik Teil des enormen Kulturexports, der Generationen von Künstlern aus dem Gebiet des heute geeinten Italiens nach ganz Europa ziehen ließ. Auch in Frankreich ist die Mode für das Italienische groß als das Cello Anfang des 18. Jahrhunderts eingeführt wird. Im stark zentralisierten Königreich – dem ersten und einzigen Staat mit einer selbstverherrlichenden Kunstpolitik – macht sich aber auch die Tendenz zur kulturellen Vereinnahmung bemerkbar.
Stilistische Hybrid-Kompositionen (französische Musik à l’italienne für Cello) geben dazu einen guten Einblick. Schließlich sind es dann auch französische Cellisten, die im galanten Zeitalter aus der Verschmelzung von italienischem Instrumentarium und alter, französischer Spieltechnik (basse de violon) mit den Möglichkeiten und Ansprüchen von staatlich organisierten Kunst-Akademien die Cellotechnik standardisieren und so das moderne Cellospiel begründen.
Dieses Konzertprogramm führt uns durch diese Entwicklungen und erlaubt an verschiedenen Etappen mit besonders schöner Musik zu rasten. Ausgehend von Werken aus den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts im reinsten Stil der Musikzentren Rom und Venedig (Scarlatti / Marcello) spannt es einen Bogen über die Sonate des gebürtigen Neapolitaners und eigentlichen Kosmopoliten Lanzetti (die sich mitten im Werk abrupt zum Französischen hin verbeugt) bis zu Barrières französischer Cellosonate im italienischen Kleid. Der Abend endet schließlich mit dem Ausblick auf einen gesamteuropäischen Musikstil mit der spätbarock-galanten Sonate des deutsch-französischen Komponisten Jean-Balthasar Tricklir.
Mara Miribung, geboren in Bozen (Italien), aufgewachsen in den Bergen (Val Badia). Cellostudium in London. Spezialisierung für Alte Musik in Basel an der Schola Cantorum. Barockcello bei Christophe Coin und Peter Skalka. Historische Improvisation bei Rudolf Lutz (MA in spezialisierter musikalischer Performance Alte Musik). Als Cellistin ist sie in verschiedenen internationalen Ensembles tätig, u.a. Kammerorchester basel, Balthasar Neumann Ensemble, Geneva Camerata, Camerata Variabile, Cappella Gabetta, Lautten Compagney Berlin, Israel Mozart Orchestra, Café Zimmermann. Seit 2015 ist sie Gastdozentin für Barockcello an der Universidad Central in Bogotá, Kolumbien. Sie spielt in zwei Musiktheater - Produktionen des Schweizer Regisseurs Thom Luz („Unusual Weather Phenomena Project“ 2016, „Inferno“ 2017). Mara Miribung lebt als freischaffende Künstlerin in Basel.
Das Violoncello im 18. Jahrhundert ein Sonatenabend als musikgeschichtliche Laterna magica
Programma
Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
Sonata I per violoncello e basso continuo
Largo / Allegro / Largo / A tempo giusto
Benedetto Marcello
(1686-1739)
Sonata I (VI Sonate a Violoncello solo e basso continuo, Opera Prima)
Adagio / Allegro / Largo / Andante
Salvatore Lanzetti
(1710-1780)
Sonata VII (XII Sonate a Violoncello Solo e basso continuo)
Andante / Allegro / Largo / Rondeau
Jean-Baptiste Barrière
(1707-1747)
Sonata II a Tre (Sonates pour le violoncelle avec la basse continüe, Livre III)
Adagio / Allegro / Aria / Largo / Giga
Jean-Balthasar Tricklir
(1750-1813)
Sonate I (Six Sonates pour violoncelle et basse)
Allegro moderato /Adagio / Rondo Allegretto
Publiziert in Archivio
Mittwoch, 26 Juli geschrieben von Badia Musica

Trio Alba
Livia Sellin, Violine
Chengcheng Zhao, Klavier
Philipp Comploi, Violoncello
„Böhmen am Meer“ ist ein fiktiver Handlungsort aus Shakespeares Komödie „Ein Wintermärchen“. Es ist ein Märchenland, das es gar nicht gibt, eine Projektionsfläche eines utopischen Idealzustandes, der von Künstlern in ihrem Schaffen angestrebt wird und in dem Grenzen keine Rollen spielen oder überwunden werden.Chengcheng Zhao, Klavier
Philipp Comploi, Violoncello
Für Joseph Haydn bedeutete Musik die Möglichkeit, die Grenzen der Sprache zu überwinden. Sein populäres Trio in C-Dur Hob XV/ 27 mit dem humorvollen virtuosen Finalsatz ist in London entstanden und der berühmten Londoner Pianistin Therese Bartolozzi geb. Jansen gewidmet. Auf die Frage von Mozart, wie er sich denn in London verständigen wolle, antwortete er: „Meine Sprache versteht die ganze Welt“.
Josef Suk und Bedrich Smetana träumten davon, ihrem Böhmen als einem slawischen Böhmen ein Denkmal zu setzen. Bedrich Smetana, der eigentlich Friedrich hieß und erst als Erwachsener die tschechische Sprache lernte, tat dies in „Mein Vaterland“ mit der berühmten „Moldau“. Auch die Elegie op. 23 von Josef Suk steht laut Widmung unter dem Eindruck des Gedichtes von Julius Zeyer: „Vysehrad“, das nach der Prager Hochburg benannt ist. Josef Suk schrieb es für den Dichter Julius Zeyer, der ein enger Freund und plötzlich verstorben war, und ließ es unter einem „Tableau Vivant“ mit Sagengestalten aus diesem Verszyklus aufführen.
Bedrich Smetana komponierte sein einziges Klaviertrio nach dem frühen Tod seiner kleinen Tochter. Wie auch für Tschaikowsky und Schostakowitsch, deren Klaviertrios nach dem Verlust wichtiger Menschen entstanden sind, erschien ihm das Klaviertrio mit den Möglichkeiten von solistischer Intimität und sinfonischer Wucht ein geeignetes Mittel, um nicht nur seinen Schmerz, sondern auch Liebe, Trost und Versöhnung auszudrücken, ein Versuch, mit der Musik die Verzweiflung über die Unüberbrückbarkeit des Todes zu überwinden und das Leben zu feiern.
Jugendliche Frische, Leidenschaft auf der Bühne und spielerische Qualität, die auf profunder Kenntnis von Klanggestaltung und kammermusikalischen Strukturen basiert. So lässt sich die musikalische Dreieinigkeit beschreiben, die seit 2008 als Trio Alba zu hören ist.
Gegründet wurde es 2008 an der Musikuniversität Graz, wo die deutsche Geigerin Livia Sellin, die chinesisch-österreichische Pianistin Chengcheng Zhao und der italienisch-österreichische Cellist Philipp Comploi Kammermusik studierten. Das Trio gewann sofort einige Wettbewerbe (wie bei der Martha-Debelli-Stiftung) und war in Österreich mittlerweile mehrfach in Reihen der renommiertesten Konzerthäuser zu hören (Konzerthaus Wien, Mozarteum Salzburg, Musikverein Graz u.a.). Das Trio Alba wurde bereits in viele europäische Länder eingeladen, nach China, Nord - und Südamerika und tritt auch im Ausland in bedeutenden Konzerthäusern und Festivals auf (Schleswig-Holstein-Festival, Deutschland, Laeiszhalle, Hamburg, Chamberfest Ottawa, Kanada, National Centre of Performing Arts, Peking).
Beide beim exklusiven deutschen Plattenlabel MDG erschienenen CDs mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy und Joseph Marx wurden in Österreich mit dem Ö1- Pasticcio-Preis des österreichischen Rundfunks ORF ausgezeichnet.
Das Trio legt bei seiner Repertoireauswahl Wert auf eine gute Balance aus bekannten Meisterwerken und unbekannten Schätzen der Literatur. So haben sie Aufsehen mit der Einspielung der vergessenen Trio-Phantasie von Joseph Marx, einem der bekanntesten österreichischen Komponisten und Musikschriftsteller des 20. Jahrhunderts, erregt. Mehrere Komponisten wie Kelly-Marie Murphy haben für sie Stücke komponiert, im Jahr 2016 haben sie eine weltweite Tournee mit Ur - und Erstaufführungen der „Fugitive Pieces“ von Helmut Jasbar unternommen.
Trio Alba - eine Anspielung auf alba (ital. Sonnenaufgang, Morgenröte) und das schwedische Lied Se solen sjunker, das Franz Schubert zum zweiten Satz seines Klaviertrios in Es-Dur anregte.
„Böhmen am Meer“
Programma
Joseph Haydn
(1732-1809)
Klaviertrio in C-Dur hob. XV/27
Josef Suk
(1874-1935)
Elegie in Des-Dur op. 23: Unter dem Eindruck von Zeyers „Vyšehrad“
Bedřich Smetana
(1821-1884)
Klaviertrio in g-Moll Op. 15 (30')
Publiziert in Archivio
Sonntag, 23 Juli geschrieben von Badia Musica

Duo Christian Elin & Maruan Sakas
Christian Elin, Sopransaxophon und Bassklarinette
Maruan Sakas, Klavier
Mit Christian Elin und Maruan Sakas haben sich zwei Grenzgänger zu einem besonderen Duo zusammengetan: Beide Musiker sind sowohl im Jazz als auch in der Klassik zu Hause und diese Liebe zur Freiheit der Improvisation sowie zur Klarheit der klassischen Form drückt sich auch in ihren Kompositionen aus:Maruan Sakas, Klavier
Im Spannungsfeld von Jazz, Minimal Music, Filmmusik und ethnischen Anklängen stehend, zeichnet das Duo Elin-Sakas in seinem Debütprogramm mit viel Sinn für Klangschönheit eine schlichte und tiefgehende Musik, deren klanglicher Reiz durch die Vielfalt von Elins Instrumentarium – von den tiefen, dunklen Tönen der Bassklarinette bis hin zum strahlenden Sopransaxophon – noch intensiviert wird.
Die Spielweise des Duos Elin-Sakas ist geprägt von einer Haltung des kammermusikalischen Jazz: feine Töne, klangliche Raffinesse und eine große stilistische Offenheit treffen hier aufeinander und geben viel Raum für gemeinsame improvisatorische Höhenflüge.
So wie viele Werke des Duos – oft in ganz besonderen Lebensmomenten – als "Geschenke" an die Musiker selbst entstanden sind, werden sie auch zu Geschenken an das Publikum.
Die Musiker präsentieren Werke aus Ihrem Debütalbum "Some kind of Blues", das 2017 beim Münchner Label "raccanto" erschienen ist.
„Some kind of Blues“
Programm
M. Sakas
*1985
Some kind of Blues
Ch. Elin
*1976
Un pas jusqu'au seuil
En route
M. Sakas
1-2-5
M. Sakas/Ch. Elin
Juste pour le Plaisir
Ch. Elin
Le vent de l'ouest
M. Sakas
ECMS
Ch. Elin
Hymne angevine
A better job
Stella cadente
The scent of light
Publiziert in Archivio